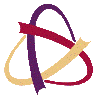Zwischenrufe
![]()
George Robinson
![]()
Peter Wattler-Kugler
![]()
Burkhard Bläsi
![]()
Europäische
Talkrunde
![]()
Der psychologische Nutzen des
No Blame Approach
Erfahrungen aus schulpsychologischer Perspektive
![]()
Herr Zweifler: Guten Tag, mein Name ist Zweifler. Ich habe das Wochenende hier mit dieser Tagung verbracht, weil mich der No Blame Approach neugierig gemacht hatte. Für mich sind aber noch ein paar Fragen offen geblieben. Vielleicht können Sie mir als Psychologe da weiterhelfen. Ich habe gehört, der No Blame Approach kommt aus der Ecke der kurzzeittherapeutischen und lösungsorientierten Ansätze.
Wissen Sie was, ich habe den Eindruck, dass sich kurzzeittherapeutisch nicht nur darauf bezieht, dass der No Blame Approach nur kurze Zeit zur Durchführung benötigt, sondern auch dass seine Wirkung nur kurzzeitig anhält! Ich kann Ihnen das auch begründen.
Mir scheint, es wird vielleicht schnell eine Lösung für die aktuelle Situation gefunden, das eigentliche Problem wird aber gar nicht angegangen. Das Problem besteht nun mal in inakzeptablen Verhaltensweisen der Mobber. Die müssen doch aber zur Einsicht gebracht werden, dass sie falsch gehandelt haben, damit das auch langfristige Wirkungen zeigt. Da braucht es doch einen inneren Wandel in deren Einstellungen, das müssten Sie als Psychologe doch wissen! Sonst machen sie es doch bei nächster Gelegenheit wieder! Die lassen vielleicht von einem Opfer ab und suchen sich dann halt das Nächste!
Herr Bläsi: Wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie also, der No Blame Approach sei mehr oder weniger eine schnell, aber nicht nachhaltig wirksame Symptomdoktorei. Ein Symptom wird gelindert, aber die Ursache des Problems bleibt unberührt und alsbald treten neue Symptome auf?
Tatsächlich ist der No Blame Approach nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Und es ist gerade der Grundgedanke solcher Ansätze, dass ich nicht erst genauestens das Problem erkennen und analysieren muss, bevor ich anfangen kann, etwas zu verändern. Anders als wir das von unseren oft linearen, kausalen Denkmustern her gewohnt sind, wird hier kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Problem, den vermuteten Ursachen eines Problems und der Lösung eines Problems gesehen. Und es wird auch nicht davon ausgegangen, dass die Lösung so komplex sein muss wie das Problem selbst.
Steve de Shazer, einer der Begründer der lösungsorientierten Kurztherapie, hat dafür die Metapher des Türschlosses verwendet. Ein Schloss ist von der Konstruktion her ein ziemlich komplexes Gebilde. Ein Schlüssel, mit dem man das Schloss aufschließen (und damit das Problem der verschlossenen Tür lösen) kann, hat dagegen meist eine relativ simple Gestalt. Es ist hier nicht notwendig, genau zu verstehen, wie das Schloss beschaffen ist, aus welchem Rohmaterial es gefertigt wurde, wer alles beim Zustandekommen beteiligt war, wie es in die Tür eingebracht wurde usw. Es reicht aus, den einfach gearbeiteten Schlüssel ins Schloss zu stecken und herumzudrehen. Das heißt im übertragenen Sinne: Eine Intervention braucht nur in der Weise zu passen, dass die Lösung auftaucht, sie muss es nicht an Komplexität mit dem Problem aufnehmen.
Herr Zweifler: Nun gut, das hört sich ja nett an mit dem Schloss. Aber bleiben wir mal bei der Übertragung auf unser Thema. Oft liegt da ja die Lösung nicht schon auf dem Tisch, so wie in Ihrem Beispiel gerade der Schlüssel. Woher kommt denn dann die Lösung, wenn nicht aus der genauen Analyse des Problems? Ist das psychologische Hexerei?
Herr Bläsi: Nein, mit Hexerei hat das gar nichts zu tun. Lösungen entstehen hier vor allem durch die Aktivierung der Ressourcen der Beteiligten. Dadurch eröffnen sich oft überraschende neue Handlungsmöglichkeiten.
Welche Ressourcen ich meine? Zunächst vor allem: Die Aktivierung von Empathie. Das meint die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und nachzuspüren, wie diese empfinden. Und zum zweiten, damit verbunden: Die Aktivierung der sozialen Kompetenzen, d. h. der Fähigkeit zu prosozialem Verhalten. Diese Ressourcen sind bei den allermeisten Menschen vorhanden, sie werden jedoch in der aktuellen Situation nicht abgerufen. Selbst der schlimmste Mobber in einer Klasse hat sich in anderen Situationen aller Wahrscheinlichkeit nach schon einmal empathisch und prosozial gegenüber anderen verhalten, verfügt also grundsätzlich schon über die Fähigkeiten, die zur Lösung des Mobbingproblems nötig sind.
Wie wird nun der Schatz dieser zunächst verborgenen Ressourcen gehoben? Hier sind beim No Blame Approach vermutlich unterschiedliche Mechanismen am Werk.
Entscheidend scheint mir das Umdefinieren von „Tätern“ in „Experten“ zu sein. George Robinson hat in seinem Workshop darauf hingewiesen, welche Wirkung ein bestimmtes Labelling einer Person mit sich bringt. In der Tat hat sich in Soziologie, Kriminologie und Sozialpsychologie ein großer Fundus an Arbeiten angehäuft, die zeigen, welche manchmal gravierenden Konsequenzen eine bestimmte Stigmatisierung auf das Selbstbild und das Verhalten von Personen haben kann.
Wenn beim No Blame Approach die Mobbenden als Experten bezeichnet werden, bleibt dies nicht ohne Auswirkung auf deren Selbstkonzept. Unterstützt wird damit ein positives, prosoziales Selbstbild, mit der Folge, dass sich die Mobbenden im weiteren Verlauf auch eher wie Experten denn wie Täter verhalten werden.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist wahrscheinlich, dass mit dieser Umdefinition ein erheblicher Stressabbau einhergeht. Im Vergleich mit konfrontativen Mobbing-Interventionen wird kein Druck auf die Mobbenden aufgebaut, sondern Druck genommen, weil sie eben nicht an den Pranger gestellt werden. Aus der Psychologie wissen wir wiederum, dass Menschen unter stressfreien Bedingungen viel wahrscheinlicher zu prosozialem Verhalten bereit sind als unter Druck und Stress.
Und nun, lieber Herr Zweifler, zu ihrem Verdacht, es handle sich bei dem No Blame Approach um reine Symptomdoktorei. Meines Erachtens ergeben sich im Prozess der Durchführung des No Blame Approach Lerneffekte, die über die akute Situation hinausgehen. Stellt man am Ende der Nachgespräche jedem einzeln die Frage, ob er oder sie aus dem Ganzen auch irgendetwas für sich selbst mit nimmt, irgendetwas für sich gelernt hat, dann erhält man zum Teil erstaunliche Reaktionen. Hier exemplarisch einige Antworten von Schülerinnen und Schülern (7. bzw. 8. Klasse):
- „Wenn ich gemobbt werden würde, würde es mir auch schlecht gehen, darum mobbe ich jetzt auch niemanden mehr.“
- „Dass ich niemanden fertig machen sollte, nur weil er anders aussieht oder so. Weil es ihm dann schlecht geht.“
- „Ich kann jetzt verstehen, warum er so war und sich so verhalten hat, weil er war halt der totale Außenseiter. Und ich weiß jetzt, wie man mit so jemandem umgehen muss.“
- „Wenn man auf andere zugeht, dann klappt es auch.“
- „Der erste Eindruck ist ganz anders. Eigentlich ist er ja ein netter Mensch, klug, sympathisch. Merkt man aber erst, wenn man mal das mit ihm macht und ihn genauer kennen lernt.“
- „Man sollte das nächste Mal früher etwas machen, wenn man so was bemerkt, damit es gar nicht so weit kommt.“
Solche Äußerungen sind für mich Indikatoren für Veränderungen, die nachhaltig wirksam sein können. Natürlich werden sich solche Äußerungen nicht immer eins zu eins in Verhaltensänderungen niederschlagen, und natürlich erhält man auch nicht in allen Fällen derartige Antworten. Aber schon wenn bei einigen Schülern durch eine solch kurze Intervention ein langfristiger Veränderungsprozess in Gang gesetzt werden kann, wäre das für mich ein großartiger Erfolg.
Schließlich noch eine letzte Anmerkung, weil sie mich „gerade als Psychologe“ auf offenbar notwendige Einstellungsänderungen angesprochen haben.
In der Psychologie hat man schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass eine Einstellungsänderung einer Verhaltensänderung nicht unbedingt vorausgehen muss. Im Gegenteil, es kann auch andersherum laufen: Die Einstellungsänderung folgt der Verhaltensänderung. Zugrunde liegt dann oftmals das, was Psychologen als kognitive Dissonanz bezeichnen: Menschen bemerken eine Diskrepanz zwischen ihrem Verhalten und ihren Einstellungen. Dieser Zustand wird als unangenehm erlebt, denn der Mensch strebt offenbar danach, zwischen den eigenen Einstellungen und dem eigenen Verhalten Stimmigkeit (Konsonanz) herzustellen. Um den Zustand kognitiver Dissonanz zu beenden und Stimmigkeit herzustellen, ist nun durchaus nicht selten zu beobachten, dass Menschen die eigenen Einstellungen dem vorangegangenen Verhalten anpassen. Diese veränderten Einstellungen wirken dann ihrerseits bei nächster Gelegenheit unterstützend für das besagte Verhalten, erhöhen die Wahrscheinlichkeit des erneuten Auftretens dieses Verhaltens.
Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Durchführung des No Blame Approach bei den Mitgliedern der Unterstützungsgruppe eben solche Prozesse ablaufen: Die Mobber zeigen, animiert durch das Gespräch in der Unterstützungsgruppe, neue Verhaltensweisen, und ändern in der Folge auch ihre Einstellungen gegenüber der gemobbten Person. Wahrscheinlich finden die von ihnen geforderten Einstellungsänderungen also tatsächlich statt, Herr Zweifler, nur womöglich auf andere Weise, als sie das vermutet haben.
Herr Zweifler: In Ordnung. Die Täter lernen also in diesem Prozess auch etwas dazu, obwohl sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann ich nachvollziehen. Auch wenn das meinem Gerechtigkeitsempfinden immer noch etwas widerspricht.
Aber lenken wir den Blick einmal auf das Mobbingopfer. Das befindet sich doch aufgrund des Mobbings in einer völlig hilflosen Situation. Der oder die hat meist schon alles Mögliche probiert. Hat versucht sich verbal zu wehren: nichts gebracht, Mobbing ging weiter, Hat versucht, zu den anderen besonders freundlich zu sein: nichts gebracht, Mobbing ging weiter. Hat versucht, möglichst unauffällig zu bleiben: nichts gebracht, Mobbing ging weiter. Jetzt kommt jemand von außen und sagt: „Ich will dir helfen und will versuchen, eine Lösung für dich zu finden. Du musst dabei gar nichts tun.“ Bestärkt das denn nicht erst recht das Hilflosigkeitsgefühl des Mobbingopfers? Das Gefühl von “Ich kann nichts ausrichten“, „Ich bin auch gar nicht wichtig, wenn es um die Klärung der Situation geht, auch die Erwachsenen meinen, dass ich gar nichts selbst dazu beitragen kann, damit es wieder besser wird“?
Herr Bläsi: Sie meinen also, das negative Selbstbild des Mobbingopfers verstärkt sich zu Beginn des No Blame Vorgehens erst einmal weiter, weil ihm bei der Intervention scheinbar eine passiv-hilflose Rolle zugewiesen wird?
Hier kann ich sagen: Das entspricht schlicht nicht meinen Erfahrungen - und wahrscheinlich auch nicht den Erfahrungen vieler der hier Anwesenden. Zu spüren ist bei den Betroffenen zwar noch nicht gerade Optimismus; und das Gefühl der Hilflosigkeit ist vermutlich nicht auf einen Schlag wie weggeblasen, dafür haben die Betroffenen zuvor zu viele negative Erfahrungen gemacht. Aber merklich ist doch immerhin eine gewisse Erleichterung.
Und zwar eine Erleichterung in dreierlei Hinsicht:
- Erleichterung, dass der Betroffene selbst nichts tun muss. Gerade weil er zuvor im Rahmen seiner Möglichkeiten meist schon alles versucht hat, um das Mobbing zu beenden, damit aber keinen Erfolg hatte, ist er froh, als gebranntes Kind jetzt nicht wieder selbst ins Feuer langen zu müssen.
- Erleichterung darüber, dass die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Meiner Erfahrung nach ist das zur Rechenschaft ziehen oft eher ein Bedürfnis der Eltern oder der Lehrkräfte, nicht das der Betroffenen. Warum? Weil die Angst oft sehr groß ist, dass eine Bestrafung der Täter dazu führen könnte, dass diese sich anschließend wiederum am Betroffenen rächen.
- Erleichterung, dass sich der Betroffene nicht rechtfertigen muss, er sei womöglich selbst schuld am Mobbing. Das Prinzip „No Blame“ gilt ja nicht nur für die Mobber, sondern auch für die Gemobbten! Dies ist im Schulalltag nicht unbedingt selbstverständlich, es kommt immer wieder vor, dass Mitschüler, Eltern oder Lehrkräfte dem Gemobbten die Schuld oder zumindest eine Mitschuld an Mobbingvorfällen geben.
Doch selbst wenn da in gewissen Fällen etwas dran sein sollte, helfen Schuldzuweisungen in dieser Richtung genauso wenig weiter wie in die andere. Zum einen ist es nämlich unwahrscheinlich, dass ein Mobbingopfer in einer akuten Mobbingsituation von alleine sein Verhalten verändern kann, vor allem aber ist es so, dass Verhaltensänderungen der Mobbingopfer in aller Regel noch lange nicht die Mobbingdynamik auflösen.
Durch diese dreifache Erleichterung wird dem Betroffenen erst einmal Druck genommen, der enorme psychische Stress wird reduziert. In der Folge wird auch hier der Rückgriff auf die eigenen Ressourcen wieder wahrscheinlicher.
Herr Zweifler: Nun gut, einmal angenommen, das Mobbingopfer fühlt sich tatsächlich erst einmal erleichtert, weil überhaupt etwas getan wird und weil ihm vor allem die Angst genommen wird, dass die Mobber bestraft werden und ihn dann erst recht wieder belästigen.
Ich bleibe dennoch bei meiner Frage: Was lernt die vom Mobbing betroffene Person? Die darf ja einfach beobachten, abwarten, was passiert, und sich dann am positiven Ergebnis erfreuen. Aber selbst tut sie nichts dazu. Und sie lernt ja in diesem Prozess auch nichts dazu. Ich habe nun einige Mobbingfälle in der Schule mitbekommen. Ich muss sagen, so völlig ohne Eigenanteile des Mobbingopfers ist das nicht immer abgelaufen. Müsste nicht auch noch mehr mit den Mobbingopfern gearbeitet werden? Damit die nicht in einer anderen Situation bald wieder zum Mobbingopfer werden? Denn diese Beobachtung mache ich leider immer wieder.
Um es zugespitzt zu formulieren, Herr Bläsi: Ich habe den Eindruck, die Vernachlässigung der weiteren Arbeit mit dem Mobbingopfer stellt einen blinden Flecken des No Blame Approach dar!
Herr Bläsi: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, die Frage der Weiterarbeit mit den Betroffenen. In manchen Fällen kann eine solche Weiterarbeit nämlich in der Tat sehr sinnvoll sein, in anderen erscheint sie mir dagegen nicht unbedingt nötig.
Die Notwendigkeit weiterer Begleitung hängt meines Erachtens ab von den Ressourcen, über die Mobbingbetroffene zum Zeitpunkt der Beendigung des Mobbings verfügen.
Als wichtigste Ressourcen in diesem Zusammenhang sehe ich:
das Selbstwertgefühl, das soziale Netz außerhalb der Mobbinggemeinschaft, soziale Kompetenzen. Der Ausprägungsgrad dieser Ressourcen hängt mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen, mit solchen, die vielleicht auf frühere Lernerfahrungen zurückzuführen sind, und mit solchen, die direkt mit dem vorangegangenen Mobbing zu tun haben können:
|
Persönlichkeit Familiengeschichte Frühere soziale Beziehungen Frühere Lernerfahrungen ...
|
Selbstwertgefühl Soziales Netz Soziale Kompetenzen Reflexionsfähgikeit
|
|
Ausprägung des Mobbings Dauer des Mobbings Wiederholte Mobbingerfahrung |
Ich empfehle darum nach Beendigung des Mobbings, in einem Gespräch mit dem Betroffenen eine Art „Ressourcen-Check“ durchzuführen, d. h. eine Einschätzung vorzunehmen, wie es um die aktuellen Ressourcen bestellt zu sein scheint.
Bei einem spürbaren Mangel an besagten Ressourcen ist es sicher sinnvoll, mit dem Betroffenen weiterzuarbeiten, z. B. zu den Themen Selbstwertstärkung, Wiederaufbau von Vertrauen in soziale Beziehungen oder Training sozialer Kompetenzen. Dies kann in Form einer Einzelberatung oder eines Gruppentrainings geschehen.
Je nachdem, an welchen Ressourcen es am meisten mangelt, können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. In der Mobbingliteratur wird zuweilen unterschieden zwischen passiven, hilflosen Mobbingopfern und sogenannten wehrhaften Opfern, die vielleicht auch selbst einen Teil zur Eskalation beitragen. Bei ersteren wird wahrscheinlich zunächst der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls im Vordergrund stehen, bei letzteren eher die Reflexion des eigenen Verhaltens mit dem Ziel der Gewinnung neuer Handlungsalternativen sowie das konkrete Einüben neuer Verhaltensweisen.
Ganz wichtig ist aber, dass diese Arbeit nach der Beendigung des Mobbings ansetzt, wenn der Betroffene sich in einem sicheren Zustand befindet. Der Schutz des Mobbingopfers vor weiterem psychischem Leid muss zunächst absoluten Vorrang haben.
Ich geben Ihnen also vollkommen recht, Herr Zweifler, der Bedarf an einer Weiterarbeit mit den Mobbingbetroffenen sollte stets mitbedacht werden. Ich sehe dies dennoch nicht als blinden Fleck des No Blame Approach, sondern eher als eine sinnvolle Ergänzung des Vorgehens. Schließlich nimmt der No Blame Approach ja auch gar nicht für sich in Anspruch, auf einen Schlag sämtliche individuellen und sozialen Probleme in einer Klasse zu lösen. Das Ziel, um das noch einmal klar zu sagen, ist zunächst und vor allen Dingen die Beendigung einer Mobbingsituation, um das Mobbingopfer zu schützen. Weitere Maßnahmen – wie zum Beispiel auch Klassenprojekte zum sozialen Lernen – können jedoch hervorragend daran anschließen.
Herr Zweifler: Hm... Okay, ich habe erst einmal keine weiteren Anmerkungen.
Herr Bläsi: Ich danke Ihnen für das Gespräch und die anregenden Fragen, Herr Zweifler.
No Blame
Approach - zurück
- ![]() -
- ![]()
"Zwischenruf" von Dr. Burkhard Bläsi
![]() Der "Zwischenruf" als pdf-Datei-Download
Der "Zwischenruf" als pdf-Datei-Download
Über die Geprächsteilnehmer des Zwiegesprächs
- Herr Zweifler lebt als kritischer Bürger in Argwöhnstadt
- Dr. Burkhard Bläsi arbeitet als Schulpsychologe an der Schulpsychologischen Beratungstelle Stuttgart

- Kontakt:
 Burkhard Bläsi
Burkhard Bläsi